Nach 68 Zu Jacques Rivettes Out 1: Noli me tangere
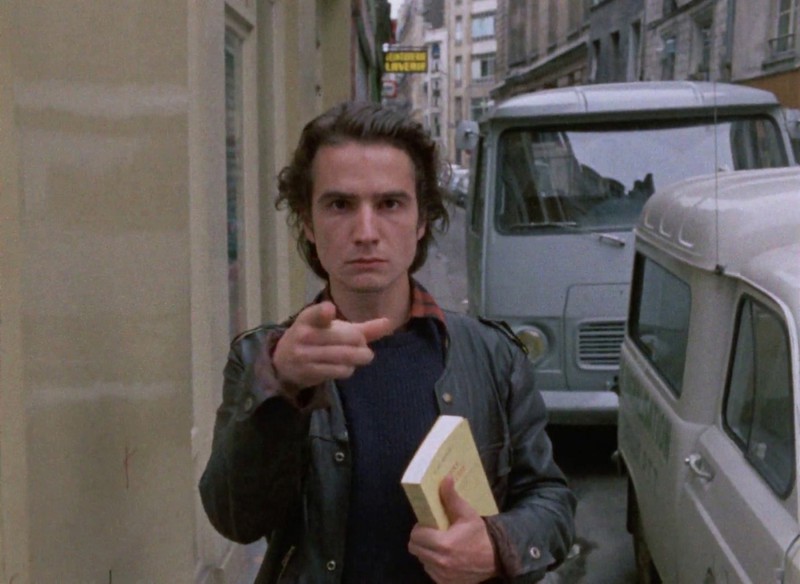
Out 1: Noli me tangere
© Les Films du Losange
Rivette hat für einige seiner Filme ein Theaterstück als Ausgangspunkt genommen. Schauspieler proben im Theater ihre Rollen, die im Alltag nachwirken, in dem sie wiederum andere Rollen innehaben. Out1 verdoppelt diesen Ausgangspunkt: Im April 1970 arbeiten in Paris zwei Theatergruppen an Stücken von Aischylos. Thomas (Michael Lonsdale) probt mit seiner Truppe Der gefesselte Prometheus, Lilli (Michèle Moretti) inszeniert Sieben gegen Theben. Die Stücke liefern den Theatergruppen das Material, um neue Spielweisen und Arbeitsformen zu erproben. Man ahmt die Neuerungen nach, die durch Jerzy Grotowski, Peter Brook oder das Living Theatre etabliert wurden. Die Stücke des Aeschylus sind wie ein Passepartout für die Zeit nach 68.
Der gefesselte Prometheus besitzt, wie Robert Lowell anlässlich seiner Übertragung des Stücks ins Amerikanische, die Peter Brook angestoßen hatte, herausstellt, eine «undramatic quality» und die «blessed freedom of plot». Prometheus hat gegen Zeus, den er im Kampf gegen die Titanen noch unterstützt und dem er damit zur Herrschaft verholfen hatte, aufbegehrt. Allein das Wissen, dass es eine Frau gibt, die einen Sohn gebären wird, der mächtiger sein wird als sein Vater, schützt Prometheus. Denn Zeus fürchtet, dass eine falsche Frauenwahl ihn letztlich stürzen könnte, und er verzichtet deshalb auf die Vernichtung des Prometheus und schmiedet ihn stattdessen zur Strafe an den Felsen. So weit die Vorgeschichte.
Das Stück selbst spielt in einer Wartezeit, in der die Konflikte bereits entschieden und noch nicht wieder ausgebrochen sind. Der Ausdruck wird zum Rückzugsgebiet des Handelns. Als Brook gemeinsam mit Micheline Rozan 1970 das Centre International de Recherche Théâtrale in Paris gründete, diente ihm der Prometheus-Stoff als Grundlage für das mit Ted Hughes verfasste Stück Orghast at Persepolis, das Riten, archaische Praktiken und Zustände des Unbewussten in einer eigens erfundenen Kunstsprache präsentiert.
Während der Prometheus die Frage aufwirft, wie man zum Handeln gelangen kann, und ob eine Revolution gegen den übermächtigen tyrannischen Göttervater Zeus überhaupt möglich ist, stellt Sieben gegen Theben das Problem, welcher Nexus zwischen dem Unbewusstem und politischem Handeln besteht. Die Hauptfigur des Stücks, Eteokles, der Sohn des Ödipus, ist so etwas wie die Verkörperung der besonnenen politischen Führung. Als die Stadt jedoch bekriegt wird, flammt der Fluch des Ödipus wieder auf. Mit der Verteidigung der Stadt vollzieht Eteokles einen ihm unbewusst auferlegten Zwang. Er schickt sechs thebanische Helden an die Stadttore aus, um dem angreifenden Feind entgegenzutreten, und er selbst zieht zum siebten Tor, wo er auf seinen Bruder Polyneikes trifft. Die Brüder töten einander wechselseitig im Kampf.
Out 1 ist genau datiert: zwei Jahre nach 68. Er scheint wie ein ethnologischer Film eine Situation festzuhalten, die durch Stagnation, Blockaden, Epigonentum, aber auch durch Suchbewegungen, hektischen Aktionismus, Aufbruch gekennzeichnet ist. Die zwei Fassungen von Out 1 sind Explorationen dieser Situation nach 68 von unterschiedlicher Dauer. Die lange Fassung von insgesamt 773 Minuten, die den Untertitel Noli me tangere trägt, bildet eine Serie, die sich über acht Episoden erstreckt; die kürzere Fassung mit dem Untertitel Spectre besteht aus zwei Teilen von insgesamt 225 Minuten. Den Filmen hat die komplizierte Geschichte ihres kommerziellen Misserfolgs ein Nachleben im Hörensagen beschert: 1971 war eine Arbeitskopie der langen Fassung einmalig in Le Havre gezeigt worden; eine für das französische Fernsehen geplante Ausstrahlung der Serie kam nicht zustande. Spectre lief 1974 für nur kurze Zeit in den Kinos. Der WDR konnte Rivette schließlich dafür gewinnen, aus der Arbeitskopie eine Fassung zu erstellen, die 1990 in den dritten Programmen der ARDgesendet wurde und seither auf verschiedenen Festivals zu sehen war.
Gelenkter Zufall
Auf einen ersten Blick scheint Out 1 so fern gerückt wie die verblichenen Farben der 16 mm-Kopie (Spectre) bzw. des Sendebands des WDR (Noli me tangere), von denen die DVD-Edition von Absolut Medien gezogen wurde. Man kann seine Vorstellung oder Erinnerung, was die Zeit nach 68 gewesen sei, nicht zuletzt deshalb so bequem auf die Filme projizieren, weil sie handliche Erklärungen verweigern. In den Einstellungen des Films, die der Probenarbeit gewidmet sind, ist zwar zu sehen, welche Hoffnung in die Erneuerung des Theaters gesetzt wird. Aber es ist auch unübersehbar, welche autoritären Verhaltensweisen und Strukturen in die Theatergruppen eingelassen sind. Insbesondere die Truppe um Thomas scheint angetreten, eine bissige Bemerkung von Jan Kott ins Recht zu setzen: «Auf der Probe ist der Regisseur der Erste nach Gott. Und wenn es Gott nicht gibt, so ist er Gott persönlich.»
Zwei Kunstgriffe des Films stechen besonders hervor. Erstens die Länge der Einstellungen: Deren schiere Dauer retardiert die Progression einer Erzählhandlung, die nicht mehr als kohärente Verkettung von Aktionen und Reaktionen, sondern allenfalls als eine Art von Gewebe zu begreifen ist. Zweitens der Verzicht auf ein Drehbuch: An die Stelle von vorab festgelegten Einstellungen trat die Improvisation der Szenen auf Grundlage einer knappen, vagen Skizze, die Rivette zu Drehbeginn mitbrachte. Die improvisierten Szenen sind einerseits unterbestimmt, da nicht festgelegt war, welche Bewegungen, Gesten, Handlungen die Körper ausführen, wie sie aufeinander reagieren und was gesagt wird. Andererseits kann eine Erzählhandlung solche improvisierten Szenen überdeterminieren, indem sie sie in ein Muster, einen Plot, ein Genre einpasst. Wenn Reden, Gesten, Bewegungen, Spielweisen narrativ eingerahmt werden, wirken diese Rahmungen auf das, was sichtbar, hörbar ist, zurück und legen so fest, was die Szene gewesen sein wird: das Ausprobieren von etwas Neuem oder dumpfe Wiederholung eines sinnlosen Rituals, politische Aktion oder therapeutische Übung, gemeinsame Entscheidung oder Aushandlung einer Hackordnung usw.
In Noli me tangere fassen schwarzweiße Standbilder jeweils die vorherige Episode einleitend zusammen, gehen dann in Bewegtbilder über und gleiten schließlich in den Farbfilm. Diese Sequenzen demonstrieren in nuce, was von einem Geschehen zurückbleibt: eine Erinnerung an prägnante Momente sowie die Imagination, was diese verbunden haben könnte. Das Erzählen ist nicht zwangsläufig auf eine Plotbildung hin angelegt, sondern es drängt allenfalls darauf, dass es weitergeht. Die elementare Erzählfunktion ist nicht die Schürzung und Auflösung eines (dramatischen) Knotens, sondern die bloße Fortsetzung. Out 1 wird die Erwartung, dass sich die Linien des Geschehens kontrahieren und eine Abfolge von Szenen in einen Plot münden müssen, als Wunschdenken entlarven. In dem Film steckt kein Handlungsskelett, das vom Fleisch der Szenen nur bedeckt wäre, aber in einer Nacherzählung zum Vorschein käme. Diese Spannung zwischen einer Erzählung, die auf einen Plot hin gravitiert, und dem theatralen Spiel wird in der Handlung des Films selbst thematisch, in der sich die Wege von Colin (Jean-Pierre Léaud) und Frédérique (Juliet Berto) mit den Theatergruppen berühren.
Out 1 verknüpft die Draufsicht auf ein Geschehen, dessen Linien einander näherkommen, kreuzen und wieder auseinanderlaufen, mit dem Verfahren des gelenkten Zufalls, wie es etwa Pierre Boulez in seinen Kompositionen erprobt hat. Hierbei wird eine Linie durch ein kontingentes Ereignis, das aus ihrer Kreuzung mit einer zweiten Linie resultiert, abgelenkt und in ihrem weiteren Verlauf mitbestimmt. Das Zusammentreffen der Linien schränkt Dynamik und Richtung der Trajektorien ein, provoziert weitere Ereignisse, erzeugt Ähnlichkeiten und Korrespondenzen, sodass nachträglich im Geschehen der Zufall ein Muster hervorgetrieben haben wird, das wie von einer unsichtbaren Hand gewebt scheint.
Der gelenkte Zufall kommt durch Colin in Gang, der nichts mit den Theatergruppen zu tun hat. Er ist in seinem Alltag in die Rolle eines Bettlers geschlüpft, also einer Figur, der die Verstellung als zweite Natur attribuiert worden ist. Er mimt einen Taubstummen, der in den Straßencafés einen Obolus einstreicht, indem er «Schicksalsbotschaften» verteilt und überlaut in seine Mundharmonika bläst. Als er selbst zufällig geheimnisvolle Botschaften erhält, löst dies ein regelrechtes Interpretationsdelirium aus: Er deklamiert immer und immer wieder ein Unsinnsgedicht, das Lewis Carolls The Hunting of the Snark nachempfunden ist, und wähnt sich einer Gruppe von dreizehn Verschwörern auf der Spur, die sich nach dem Vorbild von Balzacs Histoire de treize geformt hätten. Von einem Professor (Eric Rohmer) lässt er sich über Balzacs Dreizehn unterrichten: Was den Experten jedoch interessiert, ist nicht so sehr die mögliche Existenz einer Gruppe als vielmehr die spezifische Plotkonstruktion Balzacs, die den Schein eines kohärenten Zusammenhangs erweckt.
Das Verfahren des gelenkten Zufalls verlangt vom einzelnen Schauspieler (oder Musiker) weniger, eine wichtige Rolle, einen wichtigen Part in einem Stück zu spielen, sondern in jedem Moment einfach nur so gut zu spielen, wie er kann. Das Modell gelingenden Spiels, dem Rivette anhängt, folgt im Wesentlichen Diderots Paradoxe sur le comèdien. Wer spielt, muss die Illusion, die er mit seiner Rolle errichtet, durchschauen und seine Darstellungsmittel effizient einsetzen. In dem Maße, in dem Colin der Illusion erliegt, dass es eine geheime Verschwörung gebe, tritt er aus seinem alltäglichen Rollenspiel heraus, um stattdessen deklamierend durch Paris zu hasten und nach Anhaltspunkten für die Existenz der Dreizehn zu suchen. Der gelenkte Zufall beschert ihm schließlich eine Begegnung mit Emile/Pauline (Bulle Ogier), in die er sich verliebt. Die Ernüchterung, die er erfährt, als er von ihr zurückgewiesen wird, setzt sich in seiner Entdeckung fort, dass die Konspiration sein eigenes Hirngespinst war. Er sei «der Sphinx begegnet», resümiert Colin, aber «habe die falsche Frage gestellt».
Rivette hat einmal die schelmische Auskunft gegeben, dass es für Kinder ein Vergnügen sei, Verschwörungen zu imaginieren, um sich über eigene Unzulänglichkeiten und Missgeschicke hinwegzutäuschen. Zwar resultiert aus der Einsicht, dass Ödipus keine dramatische Urszene, sondern nur eine Geschichte ist, ein Remedium gegen die fatalen Effekte einer Plotbildung, aber noch kein Handlungsprogramm, das über das alltägliche Rollenspiel hinausführt: Colin mimt in der letzten Episode von Nolime tangere wieder den Taubstummen und verteilt seine «Schicksalsbotschaften» in den Straßencafés.
Geld und Begehren
Frédérique fristet ihr Leben als kleine Betrügerin und Diebin. Während Colin wie eine Monade agiert, ist ihre Strategie auf den Übertritt jener unsichtbaren Grenzen gerichtet, die die Leute um sich herum ziehen. Sie tritt in den Cafés an sie heran, verwickelt sie in Gespräche und ergaunert von ihnen ein wenig Geld. Jedoch muss sie hierbei auch Schläge und Tritte einstecken, und eine Einstellung, die so lange währt, bis das Handgemenge entschieden ist und sie zusammengeschlagen am Boden liegt, stellt eine innerliche Beziehung von Spiel, Illusionsbildung und Gewalt aus. Wenn das Spiel unmittelbar auf seine monetäre Verwertung zielt, der Zuschauer aber diese Strategie durchschaut, wird ein aggressiver Rückstoß provoziert; wenn das Spiel keine Illusionsbildung mehr zulässt, fällt das Ereignis unter das Gesetz des Geldes, das sich in letzter Konsequenz in schierer Gewalt exekutiert.
Frédériques vom Geld gesteuertes Begehren produziert selbst wiederum gelenkte Zufälle. Sie beginnt mittels gestohlener Briefe, in denen von einer Gruppe der Dreizehn die Rede ist, verschiedene Leute zu erpressen; sie verführt Renaud (Alain Libolt), den sie mit der Geschichte, es gebe eine Bande, die einen großen Coup plane, angereizt hat; und schließlich wird sie, als diese Fiktion handgreiflich wird und das Paar öffentlich mit Revolvern herumspielt, von Renaud zufällig erschossen. Auch wenn der schnöde Glückswechsel dem Verlauf scheinbar ein melodramatisches Schema unterlegt, wirft diese Wendung, die weder Ausdruck eines Todestriebs ist noch einen Nexus von Schuld und Strafe herstellt, keinen Sinngewinn ab.
Der Film führt seine Linien – die Theaterarbeit, die Geschichten von Colin und Frédérique – nicht zusammen, sondern montiert sie ineinander. Während die Improvisation den Aktionen ihre Schwere nimmt, wird deren narrative Überdetermination durch das Hin und Her zwischen theatralem Spiel und Film blockiert. Die Improvisation und der rituelle Vollzug von Übungen sollen die Klischees austreiben, die im Schauspielern selbst stecken. Wenn das Schauspielern seine Gewohnheiten abstreift, vermag es ein «ontologisches Präsens» herzustellen. So hat Rivette in einem Artikel über Renoirs The Southener einmal «den Augenblick» genannt, den der Film «an seinen Quellen einfangen» könne. Der Kunstgriff, durch Verzicht aufs Drehbuch und durch Improvisation die einzelne Szene unterbestimmt zu lassen, findet seine Fortsetzung in einer Montage, die erst nachträglich aus den einzelnen Aufnahmen eine Geschichte formt. Rivette kombiniert die Freiheit, wie sie Jean Renoir seinen Schauspielern gelassen hatte, mit einer Erforschung des Körpers, wie sie Peter Brook betreibt, um trotz des Netzes der Symmetrien, Doppelungen, Umkehrungen und Ähnlichkeiten eine Situationen offenzuhalten.
In den ersten Folgen von Noli me tangere verharren die Einstellungen lange Zeit auf den Proben in den Innenräumen. Oder sie folgen Colin oder Frédérique in die Stadt. Jedenfalls schafft die Montage keine Konnexion zwischen Orten, wo keine ist: Das Theater besitzt zwar einen Backstage, aber kein Draußen. Die Proben sind von ihrer Umgebung, einem Draußen, wie abgekoppelt, und allein Zufall und Not treiben die Schauspieler an die Endstationen der U-Bahn bzw. Stadttore oder an die normannische Küste. Dass die Kamera den Platz im Theaterpublikum verlässt, mobil wird und, indem sie in die Stadt und ans Meer führt, sich ihren eigenen Raum erschafft, macht nicht zuletzt den Charme des Films und seine Komplizenschaft mit seinen Figuren aus, etwa wenn er in der Großaufnahme des unablässig deklamierenden Colin die Differenz von Stimme und Sinn festhält; wenn er Frédérique nach einem geglückten Trick durch den Filmschnitt entfliehen, ins Off entkommen oder im glatten Raum der Stadt verschwinden lässt, der niemandem gehört und allen Asyl gewährt; oder wenn er in den langen Plansequenzen geduldig der Theaterarbeit folgt und wartet, dass ein Funke überspringt. Wenn die Kamera sich bewegt, pausiert, ihre Bewegungsrichtung ändert, pausiert, und sich erneut bewegt, erzeugt sie einen vermittelnden Blick, der trotz der wechselnden Standpunkte nicht die Gesamtheit des Geschehens erfasst: Es geschieht – selbst auf der Bühne – stets viel mehr, als zu sehen und hören ist. Das Problem des partikularen Blicks liegt weniger in der Begrenztheit einer Perspektive oder der Relativität der Standpunkte als vielmehr in der kontingenten Festlegung. Die Entscheidung für diesen und jenen vermittelnden Blick sucht ihre Rechtfertigung darin, wie das, was nicht zur Sichtbarkeit gelangt, dennoch zur Anwesenheit gebracht wird. Was immer auch geschieht, es passiert immer noch viel mehr, das auch wichtig, aber aktuell nicht sichtbar oder hörbar ist. So sind in Spectre auch immer wieder schwarzweiße Standbilder in die Einstellungen einmontiert, die prägnante Momente eines Geschehens zeigen, das mit der aktuellen Sequenz in keinem unmittelbaren Zusammenhang steht.
Rivette setzt an die Stelle einer Theaterbühne, die im Auftritt ein Verhältnis von sichtbarem On und nicht sichtbarem Off konstituiert, die filmische Einstellung, die sich durch ihr implizites Verhältnis zu einem Geschehen definiert, das von Auge und Ohr nicht erfasst wird. Es scheint, zum Beispiel bei den Theaterproben der siebten und der achten Episode, als ob die Kamera selbst bei einfachen Aktionen nicht mehr mit den Geschehnissen Schritt halten könnte und dem, was passiert, einen Handlungsüberschuss gäbe, der über den aktuellen Rahmen hinausdrängt. Stets gibt es etwas, das in der Einstellung anwesend, aber außerhalb von ihr ist und das man in Anlehnung an den Filmtitel das Out oder Außen nennen könnte. Was André Bazin die kaschierende, abdeckende Funktion der Einstellung nannte, die, indem sie einen Ausschnitt wählt, den Zuschauer zu einer Fortsetzung der diegetischen Welt über den Bildrahmen anreizt, wird im Out zu einer neuen Qualität gesteigert. Denn die Einstellung reizt nicht mehr nur wie ein Cache die imaginäre Fortsetzung und Komplettierung des Sicht- und Hörbaren an, sondern lässt den Zuschauer eine Gleichzeitigkeit von Linien, Aktionen, Geschehnissen gewahr werden, selbst wenn sie ihm unzugänglich bleibt.
In der Montage von Szenen, die auf der Handlungsebene so gut wie nichts miteinander zu tun haben, aber in gedachter Gleichzeitigkeit ablaufen, wird dieses Prinzip weiter getrieben: Die Szenen sind füreinander wechselseitig im Out. Was in der einen Szene geschieht, ist zwar auf der Handlungsebene von der anderen unabhängig, aber dennoch haben beide Teil an einem unübersehbaren Geflecht, in dem es überall Wechselwirkungen und Resonanzen gibt. Zwar verweigert der Film ein göttliches Auge, das die gleichzeitigen Szenen überblickt und ihre Relationen koordiniert. Dennoch verlaufen zwischen ihnen flüchtige Linien. In einer zentralen Szene des Films, in der Colin und Frédérique am selben Ort sind, aber einander nicht begegnen, werden diese verschiedenen Linien nicht verknotet, sondern wie durch einen Ring, eine Engstelle geführt, um anschließend wieder auseinanderzulaufen.
Laissez-moi
Die Verschwörung sind immer die anderen. Zweifellos scheint es um 68 eine Gruppe der Dreizehn gegeben zu haben, der nicht zuletzt Thomas und Lili angehörten. Doch hatte die Gruppe nichts mit einer Art von Organisation, wie ihr Colin nachjagt, oder einer korrupten Bande, wie Frédérique argwöhnt, gemein. Vielmehr scheint die Gruppe eine Art von Family, ein Kreis von Freunden gewesen zu sein, die durch gemeinsame Interessen, Solidaritäten, Projekte, Geschäfte zusammengehalten wurde, aber zerfallen ist, nachdem ihre zentrale Figur, ein gewisser Pierre, sich auf- und davongemacht hat. Zwei Jahre nach 68 hat sie sich aber überlebt, und es ist fraglich, wie eine neue Gruppe zu begründen wäre und welchen Zweck ihre Auferstehung haben könnte.
Die zwei Fassungen des Films explorieren gleichsam die zwei Schauseiten der Frage, welche Bindungskräfte eine Gruppe zusammenhalten können. Denn weder Wunschdenken noch Führertum sind irgendwie geeignete Prinzipien, um eine Gruppe zu formieren. In Spectre korrespondieren die harten Schnitte, welche die Szenen abrupt ineinander und nebeneinander setzen, mit einem Prozess des Imaginären, der durch die Verwechslung von Wahrnehmungen und Vorstellungen, durch Kombinatorik und Erwartungen angereizt wird: Frédérique verwirklicht, ungeachtet ihres Untergangs, was sie imaginiert. Das Erzählen produziert in der Abfolge der Szenen nicht nur eine diegetische Welt, sondern auch ein imaginäres Double der diegetischen Welt, das auf sie zurückwirkt, sich in ihr festfrisst und unablässig so konkrete wie fatale Effekte auslöst. Die Schlusseinstellung von Spectre zeigt Colin, wie er unentwegt mit einem Miniatur-Eiffelturm an einem Schüsselanhänger pendelt, in der Erwartung, dass die Bewegung nach dreizehn Ausschlägen innehalte. Die mutmaßliche Verschwörung ist ein Effekt von Einbildungen. In Noli me tangere erscheint hingegen die mutmaßliche Verschwörung eher als das Resultat einer Fixierung auf einen geheimen Punkt oder, konkreter, auf eine Führungsperson. Während sich Lilis Truppe auf der Suche nach einem Dieb in der Stadt zerstreut, stockt die Arbeit der Truppe um Thomas, weil sie auf ihren Leiter fixiert ist.
Die letzte Filmsequenz zeigt Thomas zusammen mit zwei seiner Schauspieler in einer Situation am Strand, die zwischen Blödelei, Fest und archaischem Ritual oszilliert. Er versucht, indem er trinkt, improvisiert und rituelle Handlungen vollzieht, zu etwas Neuem vorzustoßen, und er ruft den anderen, die ihm nachlaufen, zu: «Laissez-moi». Der Sinn dieses «noli me tangere» ist weniger «Rührt mich nicht an» oder «Haltet mich nicht fest» als vielmehr «Klebt nicht an mir» oder «Lasst los und werdet selbständig».

Out 1: Noli me tangere
© Les Films du Losange