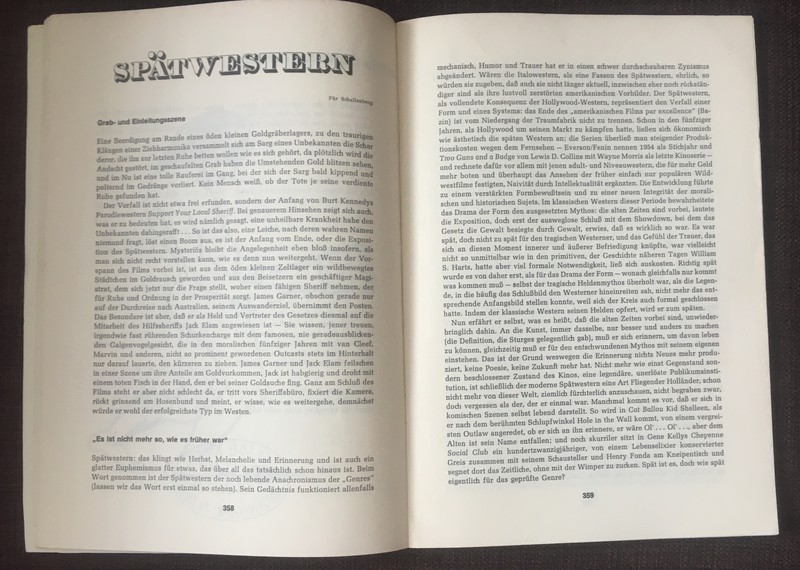31. Juli 2021
Auswegloser Schluss Die Zeitschrift FILMKRITIK vor 50 Jahren (34): Heft 07 1971
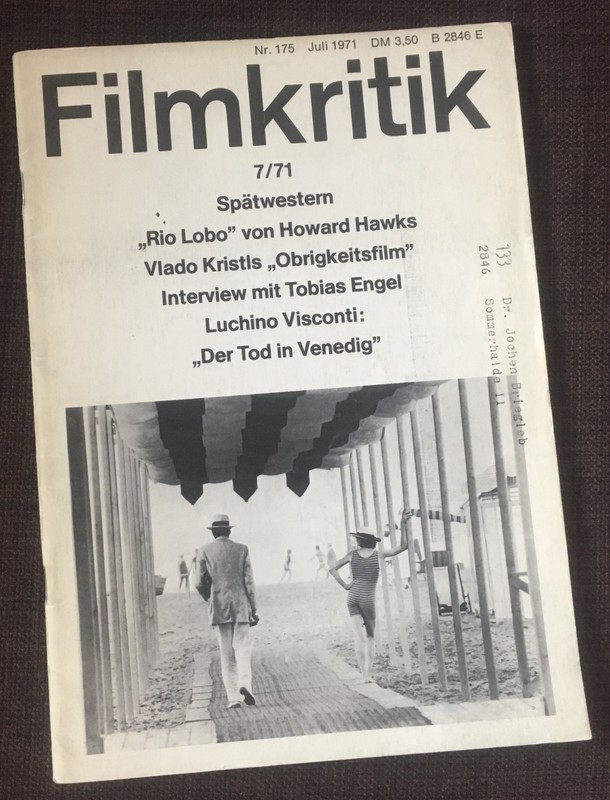
Mit dem Begriff Spätwestern ist es ein bisschen wie mit dem des Spätkapitalismus. Es gibt unterschiedliche Lesarten, zum Beispiel bei Habermas oder Jameson, aber es gibt auch einfach eine pauschale Bedeutsamkeit des Begriffs: spät ist ein Kapitalismus, auf den dann kein noch späterer folgen wird, sondern etwas anderes, denn irgendwann muss es ja auch zu spät sein, sonst macht die Rede keinen Sinn. Die interessanteste Bedeutung von Spätwestern hat mir einmal ein befreundeter Filmemacher genannt: für ihn sind das Western mit Helden, die aus dem Bürgerkrieg nicht nach Hause finden, und deswegen überall zu spät kommen, in einer Welt, die schon dem Fortschritt entgegeneilt. Auch hier gibt es eine einfachere, naheliegende Bedeutung: Spätwestern sind Western nach der Blüte des Genres. Anders als beim Begriff des Spätwerks (das mindestens bei Goethe mit vollendeter Meisterschaft assoziiert wird) ist dieser Spätwestern ein Verfallsprodukt und deutet auf das Ende entweder des Genres oder der Filmindustrie, der es entstammt.
Im Mittelpunkt des Juli-Hefts 1971 der Filmkritik steht ein großer Text von Jürgen Ebert über Spätwestern. Er vertritt die geläufige Position, dass es sich dabei um Niedergangswestern handelt, sie zeigen den «Niedergang der Traumfabrik». Der Text ist allerdings in einem stark nach intensiver Adorno-Lektüre klingenden Sinn dialektisch und hebt sein Befunde mehrmals großartig aphoristisch auch wieder auf. Ausgangspunkt ist Support Your Local Sheriff, ein Parodiewestern von Burt Kennedy, mit Jack Elam in einer Hauptrolle, also einem Darsteller, dessen Aufgabe in den fünfziger Jahren hauptsächlich darin bestanden hatte, «im Hintergrund darauf zu lauern, den kürzeren zu ziehen».
Die Rede von Spätwestern lässt sich ohne weiteres durch Frühwestern ergänzen, aber wie würde man die dazwischen nennen, also die, die in diesem Sprachbild die rechtzeitigen, die pünktlichen wären? Dafür fehlt ein geeignetes Wort, das Bazins Wort von amerikanischen Film par excellence gleichsam kairologisieren würde. Ebert weiß um die Spannung, dass die großen Western (er nennt sie auch Niveauwestern) eigentlich selbst schon um ihre Verspätung wussten. Er selbst geht nicht so weit, aber man könnte zuspitzen, dass es vielleicht nur einen Western gab, der weder zu früh noch zu spät war: Stagecoach (1939). Danach wurde das Genre schon intellektuell: «Die Entwicklung führte zu einem verstärkten Formbewusstsein und einer neuen Integrität der moralischen und historischen Sujets. Im klassischen Western dieser Periode bewahrheitete das Drama der Form den ausgesetzten Mythos: die alten Zeiten sind vorbei, lautete die Exposition, doch erst der ausweglose Schluss mit dem Showdown, bei dem das Gesetz die Gewalt besiegte durch Gewalt, erwies, daß es wirklich so war. ... Indem der klassische Western seinen Helden opfert, wird er zum späten.»
Als Gründungsjahr des Spätwesterns nennt Ebert 1962: Ride the High Country folgt auf The Man Who Shot Liberty Valance. «Wenn mit Ride the High Country eine neue Realität für den Western gegeben war, so lag das nicht zuletzt daran, dass mit diesem Film der B-Western zum A-Western kam. Das Genre hatte hiermit seinen kommerziellen Untergrund verloren, fortan stand es stolz als solches da, bemüht, sein Bestes zu geben, weil niemand es totsagen mochte, der mögliche klassenlose Western.»
Mit Peckinpah geht es dann auch auf die Zielgerade ins Ungewisse: «Ideologisch gesehen ist The Wild Bunch ein frontier-Western, der indes unmöglich so zu sehen ist, weil die Grenze, an die er stößt, die des Western selbst ist. Peckinpah überschritt sie mit der Pionierballade vom Cable Hogue, der einfach nur noch der heutige Zustand des amerikanischen Kinos ohne den Hollywood-Mythos par excellence zu entnehmen ist.»
Und dann meine Lieblingspointe: «Der Schritt vom klassischen zum Spätwestern brachte das Genre um das Bewußtsein, zu dem es an sich, innerhalb der Grenzen seiner Möglichkeiten, gekommen war, indem es bereits in seiner klassischen Form spät gewesen war.»
Dass Ebert zwischendurch The Hallelujah Trail erwähnt, als eine «freiwillige Parodie», erinnert mich daran, dass ich dem Western in der Kindheit in zweierlei Gestalt begegnet (natürlich im Fernsehen, und zeitlich vermutlich gar nicht allzuweit entfernt vom Jahr 1971): ernsthaft mit Run of the Arrow, den ich als Hölle der tausend Martern sah (und aus dem mich vor allem das Bild eines Indianerangriffs von einer Bergkuppe herunter beschäftigte), und eben unernst mit Vierzig Wagen westwärts (das Bild eines über seine eigenen Beine stolpernden Indianers erschien mir als Acht- oder Neunjährigem damals sagenhaft komisch).
Wolf-Eckart Bühler bringt dann im Anschluss an Eberts Text noch ein bisschen Westmannsgarn. Er schwärmt von dem Gruppenereignis Western, bei dem gerade auch die Nebendarsteller für das große gemeinschaftliche Ganze stehen: er hebt Hank Worden hervor (in The Big Sky: «da spielt er den blöden Indianer, Poordevil», aus heutiger Sicht natürlich eine rassistische Karikatur). Und dann dieser kleine Eintrag zu einem Schauspieler aus Rio Lobo: «JORGE RIVERO ist ein Star vieler mexikanischer Western. Er hat einige Jahre in Heidelberg Chemie studiert und eine deutsche Frau und ist bei den letzten Olympischen Spielen einer der besten Schwimmer gewesen.» Neben der Rückfrage, ob Rivero in Heidelberg «eine deutsche Frau» studiert hat oder seit Heidelberg einfach «eine deutsche Frau» hat, wäre interessant, was Bühler mit den «letzten» Olympischen Spielen meint (das müssten dann ja die von 1968 gewesen sein). Tatsächlich finden sich Hinweise, dass Rivero 1959 an Pan-American Games im Bewerb Schmetterling-Schwimmen teilgenommen hat. Ist nicht wichtig, ist nur spannend als kleines Mythologicum.
Zweiter Höhepunkt des Hefts ist ein Interview mit Tobias Engel über seinen Film No Pincha, den er in Guinea-Bissau gedreht hatte. 2014 hätte ich ihn auf der Viennale in der Schau Revolutions in 16mm sehen können, übersah ihn aber. Was Engel in einem Gespräch mit Peter Nau erzählt, weist viele Parallelen zu Godards Palästina-Filmprojekt auf. Nach dem Mai 1968 verzeichnete Engel das «Fehlen einer Theorie der militanten Praxis ... Dann habe ich ein Mädchen kennengelernt, das Geld hatte und wollte, daß es zu etwas diene.» Warum dann Portugiesisch-Guinea? «Wegen des exemplarischen Charakters der revolutionären Bewegung in diesem Land.» Vor Ort erwiesen sich alle Hypothesen als sinnlos. «So ist das Schema des Films, das man entworfen hatte, sofort verschwunden.» Engel hatte einen spezifischen Ehrgeiz mit dem Film, der von den Filmschaffenden wegführt: «Wenn ich Informationswerkzeug sage, dann auch, weil der Film ein Instrument ist, das zerbrochen werden kann. ... eines Tages (könnte es) 5, 6 or 7 Versionen (geben)... Aber das Volk von Guinea-Bissau hat in diesem Film gesprochen, und ich habe durch die Montage versucht, meine Gegenwart auszulöschen.» Nach No Pincha werde ich jetzt Ausschau halten.