Disparater Medienkörper Trumps Lizenz und die Herstellung faschistischer Gefühlsregime: Über Brian Massumis «The Personality of Power. A Theory of Fascism for Anti-Fascist Life»
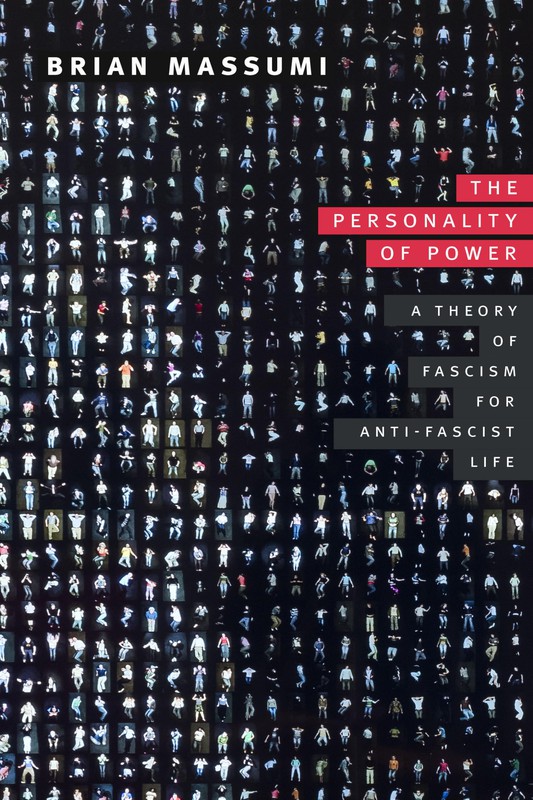
Unseren Institutionen, Ideen und Intuitionen entwischt die Wirklichkeit zunehmend. Um so verzweifelter klammern wir uns an ihnen fest. Ich gestehe: In mir hat das neue Buch des Philosophen Brian Massumi zunächst Abwehr hervorgerufen. Es ist dem Phänomen des Trumpismus gewidmet und verspricht eine Faschismustheorie für die Gegenwart. Doch wo ich mir Einordnung und Lösungsvorschläge erhoffte, lösten umfangreiche Kapitel zum Personenverständnis William James’ und Charles Sanders Peirce’ oder der Konzeption des Fehlers bei Alfred North Whitehead und Susan K. Langer zunächst ein Gefühl der Desorientierung aus, das der Überwältigung durch die Gegenwart unangenehm ähnelte. Um es offen zu sagen: Das Buch hat mich dann genervt. Warum muss ich mich fragen lassen, was für eine Art von Ding der Ozean ist, wenn ich den Wahnsinn verstehen will, der sich vor meinen Augen vollzieht, nur um daraufhin die Antwort zu erhalten, es handele sich um ein komplexes, welliges Ding? Cringe.
Ausgangspunkt dieses Umwegs ist nun allerdings eine Kritik genau derjenigen Institutionen, Ideen und Intuitionen, mit denen wir weiterhin vergeblich versuchen, die neue Situation zu begreifen. Für den kanadischen Philosophen verfehlen diese Instrumente und Kategorien des Denkens nicht einfach nur die Realität, sondern befördern so die Kanalisierung von Tendenzen in Richtung eines neuen Faschismus sogar. Auch der Faschismus betreibt ein Geschäft der Vereindeutigung und Zuschreibung, des Sortierens und Aussortierens. Der Eindruck, es durchblickt, eingeordnet und damit ad acta gelegt zu haben, ist für Massumi deshalb selbst Teil des Problems. In der Sehnsucht nach einfachen Antworten suchen wir genau dort Halt, wo etwas haltlos geworden ist. Das blockiere auch da, wo sich diese Antworten als antifaschistisch verstehen, den Ausweg. Logik selbst ist, darauf insistiert Massumi aus dieser Warte, eminent politisch. Auf die Wahl der Logik kommt es an.
An die Stelle der klassischen Logik setzt Massumi deshalb eine anspruchsvolle prozessorientierte Perspektive: Das beinhaltet die dezidierte Verschiebung von der Ontologie, also der Lehre vom Sein, hin zu dem, was er als Ontogenetik bezeichnet: die Lehre vom Entstehen. Die von Massumi vorgeschlagene prozessorientierte Logik privilegiert die Bewegung gegenüber dem Zustand und das heißt immer auch die Beziehung gegenüber der Sache, die Vielheit gegenüber dem Einzelnen und die Differenz gegenüber dem Gleichen. Das ist, darauf besteht er, nicht weniger rigoros. Auch diese Logik soll es ermöglichen, Unterscheidungen zu treffen, aber eben genauere, die der Komplexität der Wirklichkeit gerechter werden, unter anderem, indem sie die Entgegensetzung von Denken und Fühlen unterlaufen. Und tatsächlich hat mich, das sei vorweggenommen, der Entwurf dieser Logik dann doch noch mitgerissen. Abstrakte Landschaften tauchen im Kopf auf, die pulsieren. Verstanden habe ich nicht alles. Immer wieder gelingen Massumi aber in der Übersetzung von Philosophie in Gegenwartsanalyse und Gegenwartsanalyse in Philosophie Formulierungen, die etwas treffen und mir so neu aufschließen.
Es verwundert deshalb zunächst, dass der Zugang zur politischen Gegenwart, den das Buch legt, dermaßen vertraut erscheint. Ruft doch der Zugriff über die Person Donald Trump Perspektiven, Beschreibungen und Begriffe auf, die im Widerspruch zum genauen Blick auf die politischen Prozesse zu stehen scheinen, den Massumi vornehmen will: Der große Mann, der die Geschichte macht, ein charismatischer Politiker, dem seine Anhänger*innen bedingungslos folgen. Tatsächlich war es einer der Einsatzpunkte der Faschismusanalyse von Deleuze und Félix Guattari, auf deren Texte sich Massumi wiederholt bezieht, die Figur des Führers weitgehend zu ignorieren, obwohl – oder: weil – sich diese Figur mit dem Kult um Mussolini, Hitler oder Franco, den die faschistischen Regime selbst betrieben haben, dem Denken geradezu aufdrängte. Stattdessen konzentrierten sich die beiden französischen Theoretiker auf die Dynamiken zwischen den und in jedem Einzelnen, was sie Mikro-Faschismus nannten, um die Bewegungsweisen und die Attraktivität des Faschismus zu verstehen.
Auch Massumi konstatiert, dass das Modell des charismatischen Anführers nicht geeignet ist, um Trump und den Trumpismus zu verstehen: Zu oft ist dieser starke Mann allzu schwach, zu uncharismatisch ist sein Charisma, zu uneindeutig ist auch der Charakter der Make America Great Again-Bewegung, die man wohl eher als zusammengewürfelte Bande beschreiben muss, hat man die Bilder von der Kapitol-Stürmung am 6. Januar 2021 vor Augen. Doch gleichzeitig nimmt Massumi ernst, dass die Orientierung auf die Person Trump durch alle Wandlungen des amerikanischen politischen Geschehens der letzten zehn Jahre hindurch die Konstante bildet. Um Trump, nicht um ein Programm, eine Idee oder Ideologie dreht sich das politische Projekt MAGA, was sich auch daran zeigt, dass die Zustimmungsraten zur Politik und zur Person selbst unter Trumps Anhänger*innen auseinanderfallen. Diese widersprüchliche Beobachtung motiviert Massumi dazu, eine Alternative zum bekannten Bild des charismatischen Führers zu entwickeln.
Massumi schlägt dafür vor, Trump als Verkörperung eines neuen Typus der «personality of power» zu begreifen. Es handelt sich bei dieser Persönlichkeit der Macht um einen dezidiert medial konstituierten Körper, dessen erstes Auftauchen Massumi im Schauspieler/Präsidenten Ronald Reagen ausmacht, bevor er mit Trump voll zum Durchschlag kommen konnte. Es ließe sich aber auch an Silvio Berlusconi als näheren Vorläufer und Jair Bolsonaro oder Javier Milei als Varianten denken.
Die Persönlichkeit der Macht zeichnet sich nun im Gegensatz zum populären Bild des charismatischen Politikers gerade dadurch aus, dass sie keinen einheitlichen Charakter aufweist, keine konsistente politische Position einnimmt und keine kohärente Rede formuliert. Sie stellt eher so etwas wie eine Matrix dar, in der in einem einzigen Medienkörper disparate Elemente verschaltet sind. Stärke und Schwäche, Männlichkeit und Weiblichkeit, Selbstüberschätzung und Selbstironie, Verpanzerung und Verletzlichkeit sind hier keine Gegensatzpaare, sondern stehen – wenn überhaupt nur dürftig vermittelt – in zahllosen Schattierungen nebeneinander. Das Springen zwischen ihnen, wie etwa in Trumps berühmtberüchtigten Stimmungsschwankungen, droht diesen Körper jederzeit zum Zusammenbruch zu bringen. Das dramatische Flickern verschiedener Ausdrücke und Zustände gerät zum Drahtseilakt. Doch es ist gerade diese Zirkusnummer, die die Zuschauer*innen in den Bann schlägt. Das gilt für Anhänger*innen und Gegner*innen gleichermaßen, die noch jede Regung Trumps entgeistert nachverfolgen und nicht aufhören, sich angesichts dieser Show erstaunt die Augen zu reiben.
Zusammengehalten werden diese disparaten Bestandteile dabei weiterhin von Vorstellungen darüber, wie ein richtiger Mann, ein guter Präsident, ein großer Anführer zu sein hat. Ohne sie zerfiele der Körper sofort. Aber die Performance überschreitet diesen Rahmen zugleich beständig, macht ihn biegsam und dehnt ihn aus. Mehr noch: Diese Ausdehnung wird durch die besonders rigide Anrufung der klassischen Vorstellungen von Männlichkeit, Stärke, Führung, Integrität, sei es in der Selbstbeschreibung als viril oder in der Zuschreibung von Impotenz an den politischen Gegner, erst möglich gemacht.
Denn die gewaltvolle Abgrenzung nach Außen erlaubt die Integration eines enormen Spektrums an Haltungen in einen Medienkörper. Der wird damit zu einem Angebot, in dem sich wiederum eine ganze Bandbreite an Positionen und Identifizierungen etwa in Bezug auf Geschlechtlichkeit, Race oder Körper wiederfinden können, ohne einem (unerreichbaren) Idealbild entsprechen zu müssen, aber auch ohne deshalb die gewohnte und für die Dazugehörenden ja zunächst mit zahlreichen Vorzügen einhergehende Hierarchisierung der Normen aufgeben zu müssen.
Das Oszillieren selbst, die Gleichzeitigkeit der Normenanrufung und ihrer Überschreitung, macht für Massumi deshalb die besondere Kraft dieses neuartigen Medienkörpers in einer Situation aus, die er insgesamt als post-normativ beschreibt. So erteilt die Medienfigur Trump nämlich Personen, die in die derart flexibilisierte Norm fallen bzw. sich ihr unterordnen können, die Lizenz, einfach zu sein – und zwar maßlos, ohne Rücksicht auf Verluste oder, Gott bewahre, andere. Massumi nennt das eine «normativity swollen with license», eine vor Zügellosigkeit angeschwollene Normativität. Für dieses So-Sein darf sich sodann zufrieden auf die Schulter geklopft werden: I Made America Great Again. Ergebnis ist, dass die Erlaubnis, die Trump und die Trumpisten sich post-normativ erteilen, am Ende nichts anderes ist als die altbekannten weißen, heterosexuellen, männlichen Privilegien, die ihre Unhinterfragtheit zu verlieren begonnen haben. Das Bild, dass Massumi für diese Haltung findet, ist das eines verwöhnten Kindskopfs, ein Mannkind, das «mimimi» schreit.
Daraus folgt außerdem eine Revision des Verständnisses der Beziehung zwischen Führer und Masse. Für Sigmund Freud war es der psychische Mechanismus der Identifikation, der die Bindung der Einzelnen an den Führer ausmachte. Dabei wird nach Freud das Bild des Führers verinnerlicht und an die Stelle des eigenen Ich-Ideals gesetzt. Die Kontrollinstanzen des Ichs wie etwa die Realitätsprüfung werden so ausgesetzt. Es entsteht eine willenlose, gleichförmige Masse.
Massumi will zeigen, dass hier ein abgeleiteter Effekt zur Erklärung eines Vorgangs herangezogen wird, der auf der mikrologischen Ebene in anderer Weise stattfindet – gewissermaßen «bevor» es überhaupt diskrete Personen mit einem Ich-Ideal gibt, die sich identifizieren können. Die Verbindung mit dem Führer erfolgt für ihn nämlich gar nicht durch Identifikation, sondern in einem Prozess, den er als affektive Adjunktion oder als ein «adjoining» (in etwa: Beieinanderliegen) beschreibt.
Trump-Anhänger*innen verknüpfen ihr Affektleben dabei direkt mit demjenigen der Medienpersönlichkeit Trump. Es kommt zu einer Überlagerung oder vielleicht besser Verhakung zwischen der medialen Persönlichkeit der Macht und der Persönlichkeit der Einzelnen, die selbst in gleicher Weise medial konstituiert sind. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, als würde man sich bei Trump unterhaken, und so von ihm auf die Tanzfläche gezogen werden. Das Ergebnis sind dann allerdings nicht viele gleichförmige Individuen, die in Reih-und-Glied marschierend wie Abziehbildchen dem Vorbild des Führers entsprechen, sondern unendlich viele Variationen, die bestimmte Aspekte der Medienpersönlichkeit aufnehmen, andere aber eben nicht, darin zwar ihre Gangart verwandeln, auch in einen Trott fallen, aber am Ende dennoch ganz anders aussehen und sich bewegen als der ohnehin chamäleonartige Trump, und das alles ohne dass ihre affektive Verbindung darunter leidet. Das wiederum wirkt zurück auf die Medienpersönlichkeit Trump: Auch seine Gangart verändert sich durch die untergehakten Anhänger*innen. Wir müssen uns die MAGA-Bewegung als einen merkwürdigen Tanz vorstellen.
In Trumps Kommunikationsweise lässt sich diese Dynamik besonders gut nachvollziehen: Trump retweetet, wie er sich im Fernsehen sieht, wo er in einem Interview sagt, dass er gehört habe, seine Anhänger*innen denken … Sie drucken den Tweet auf ihre T-Shirts, posten ein Foto davon in die Sozialen Medien, was Trump auf seinen Plattformen teilt – und immer so weiter. Es gibt hier keinen Ursprung der Aussage mehr, nur eine kollektive Herausbildung (hier lässt sich auch an die Liebe Trumps, Elon Musks und Co zur KI-Bildgeneratoren denken, die der Bildwissenschaftler Roland Meyer herausgestellt hat). Massumi nennt das freie indirekte Rede. Ihre wichtige Formel ist «Ich habe gehört». Damit geht erneut eine weitreichende Lizenz einher, nämlich diejenige, alles zu sagen, ohne je Verantwortung für das Gesagte übernehmen zu müssen. Wichtiger als der Inhalt ist ohnehin das Sagen selbst. Gemeinsam verfestigt sich so ein Gefüge, das die Bewegung trotz aller Pirouetten und Schlenker kanalisiert. Die Richtung, in die diese Bewegung weist, ist für Massumi der Bürgerkrieg.
Warum? Was ist der Auslöser genau dieser Richtung, die der Tanz einschlägt, wenn es nicht eine Ideologie ist, oder doch der ideosynkratische Wille eines Führers, dessen Faszinationskraft sich in kollektivem Wahn leider niemand entziehen kann?
Den basalen Vorgang, der die affektive Einhakung bei Trump schließlich so attraktiv machen wird, nennt Massumi «impingement». Das meint auf der affektiven Ebene eine Art Aufprall: Die Begegnung mit der Welt stellt sich der Wahrnehmung zunächst als ein Zusammenstoß dar. An so einem Zusammenstoß sind wir, wie das «zusammen» schon sagt, aus Massumis von der frühneuzeitlichen Affektphilosophie Baruch de Spinozas geprägter Sicht immer insofern aktiv beteiligt, als es sich eben um eine Begegnung handelt. Ich erfahre mich darin deshalb als konstitutiv berührbar. Das erzeugt einen Schock oder eine Erschütterung.
Ein naheliegender Umgang mit dieser Berührung ist daher ihre Abwehr. Wenn ich nachts verschlafen zur Toilette wanke und dabei gegen ein Tischbein trete, verfluche ich den Tisch. Tatsächlich ist das Tischbein ja auch an dem Zusammenstoß mit meinem Zeh beteiligt, und dass Holz hart ist, trägt zum Schmerz bei. Aber wenn ich, lässt der Schmerz erst einmal nach, das Licht anmache, und meinen Blick auf die Situation richte, sehe ich, dass es keinen einfachen und unmittelbaren Begründungszusammenhang zwischen meinem Schmerz und dem Stuhlbein gibt. Es war nicht die Absicht des Stuhlbeins, mir wehzutun. Ich kann mich in der Situation sehen, und die Situation verwandelt sich.
Der reaktive Umgang aber verweilt bei dem umfassenden Gefühl der Erschütterung. Das erspart mir die Komplexität der Situation – allerdings um den Preis, die Begegnung sofort wieder von mir abzutrennen. Anstatt zu ergründen, was genau passiert ist, also in welcher Beziehung ich zur Situation stehe, welche Elemente die Situation hat, wie sie zusammengesetzt ist, darin meine Möglichkeiten zu handeln zu erweitern, wird das Erlebnis von dem in ihm enthaltenen Veränderungsimpuls getrennt. Er verkehrt sich so ins Negative. Das Verletzungsgefühl kreist dann um sich selbst und verstärkt sich. Es entsteht eine Art affektiver short-circuit oder Kurzschluss.
Einen einmal beschrittenen Weg schlägt man aber bequem erneut ein und so verfestigt sich ein reaktiver Umgang schnell. Die Zuschreibung von Schuld knüpft sich dabei in der Regel an einen phänomenalen Aspekt, weil er der Wahrnehmung direkt zugänglich ist. Als Charaktereigenschaft kann das dann auf die gesamte Gruppe, die diesen phänomenalen Aspekt teilt, übertragen werden.
Was bei einem Stuhlbein absurd anmutet, ist in Bezug auf Schwarze Menschen oder People of Color rassistischer Alltag. Entscheidend ist, dass der Prozess dabei von der Situation und ihrer Erschütterung auf die Ebene der Zeichen wandert. Er verselbstständigt sich also noch ein zweites Mal gegenüber dem Ereignis und kann, wie es das Wesen von Zeichen nun mal ist, frei zirkulieren.
Das mediale Milieu – Massumi hat hier konkret die Sozialen Medien vor Augen, die aber in eine Medienökologie aus Fernsehsendern, Zeitungen, Radio etc. eingebunden sind, die ihnen historisch vorausgeht – erlaubt den Transport dieser Zuschreibung an Orte, an denen es gar keinen Zusammenstoß dieser Art gab, sondern womöglich ganz andere. Hierbei geht der Kurzschluss schließlich auch seine für Massumi verhängnisvolle Allianz mit dem berühmten Commonsense und der Vernunft, wie wir sie klassisch verstehen, ein. Denn auch diese operieren über abstrakte Verallgemeinerungen und drohen dabei zu vergessen, dass diese Verallgemeinerungen das Besondere immer verfehlen und deshalb nur Hilfsmittel sein können.
Welche Rolle spielt bei alldem nun die Persönlichkeit der Macht? Sie peitscht ein. Indem sie in ihrem erratischen Oszillieren selbst Mikro-Schocks aussendet, destabilisiert sie den empfangenden und empfindenden Körper. Die Mediapersönlichkeit Trump ist eine Maschine zur unablässigen Absonderung dieser Art von verletzenden Zeichen. Gleichzeitig legen die verteilten Worte, Bilder und Gefühle den reaktiven Kurzschluss nahe. Denn der zentrale Operator von Trumps Angebot ist die Zuschreibung von Feindschaft. Dieser Operator kann im Zuge der zunehmenden Ablösung der reaktiven Formierung von den tatsächlichen Begegnungen wie gezeigt auf weit verbreitete Wahrnehmungsmuster und Erzählungen wie Antisemitismus, anti-Schwarzen oder antimuslimischen Rassismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit zurückgreifen. Dieser intellektuelle Rückgang von einer Auswirkung zu einer (böswilligen) Absicht ist außerdem der zentrale Mechanismus von Verschwörungstheorie, die in diesem Milieu fröhliche Urstände feiert.
Wieso aber setzt sich der reaktive Umgang in der Gegenwart zunehmend fest, wenn er in einer grundlegenden Funktionsweise unserer Wahrnehmung fundiert ist? Mit den Sozialen Medien ist bereits ein Aspekt benannt, den Massumi immer wieder anführt. Sie sind einerseits fundamental für die Herausbildung der Persönlichkeit der Macht als Trump-Maschine. Ständige Erreichbarkeit, Verschmelzung von medialer Persona und eigener Person sowie die Ökonomisierung der Identität verwandeln andererseits, so scheint Massumi nahezulegen, die Subjektbildung insgesamt auf eine Weise, die die Einsatzpunkte für das neue reaktive Regime vervielfältigen.
Außerdem weisen sie dabei, wie der letzte Punkt deutlich macht, eine große Schnittmenge mit den jüngsten Veränderungen der kapitalistischen Produktionsweise auf. Massumi hat hier die neoliberale Transformation vor Augen, die er makroökonomisch mit der zunehmenden Bedeutung der Finanzwirtschaft und Deregulierung verbunden, mikroökonomisch in der Prekarisierung und Flexibilisierung sowie Verwandlung von Arbeiter*innen in Humankapital ausgedrückt sieht.
Als Humankapital sind dabei, so Massumi, die ökonomischen Prozesse in einem zuvor unbekannten Ausmaß ins Innere verlegt. Wenn ich den Kapitalismus verkörpere, dann nehme ich ökonomische Schwankungen und Turbulenzen in einem emphatischen Sinne persönlich. In der Verhakung mit Trump und qua Trump mit Amerika werden nun auch alle Kurs- und Konjunkturschwankungen als direkte Angriffe auf mich empfunden, selbst wenn sie keine Auswirkungen auf das kleine Humankapital haben, das ich bin.
Diese Verhakung wiederum lässt sich hervorragend ressentimental bewirtschaften. Es gib allerdings nach Massumi keine vorgegebene Art und Weise, kein Gesetz, wie sich Kapitalismus und Faschismus zueinander verhalten, wie es etwa die verschiedenen Formeln der Kommunistischen Internationale behaupteten. Das heißt nicht, dass diese Formeln und Definitionen per se falsch sind, aber sie gingen und gehen – darin dem definitorischen Furor der neueren historischen Faschismusforschung nicht unähnlich – eben von einem (historischen) Zustand aus, aus dem sie Wesensmerkmale extrapolierten.
Da beide – Kapitalismus und Faschismus – in Massumis Perspektive aber dynamische Prozesse, eben geschichtlich und nicht einfach Geschichte sind, verfehlen diese Generalisierungen sie notwendig, was sich unter anderem an ihrem rasenden Veralten ablesen lässt. Stattdessen kommt es immer wieder zu neuen Arten der Verlinkung zwischen Kapitalismus und Faschismus, wenn sich die Prozesse berühren und in Resonanz kommen. Sie üben Anziehungskraft aufeinander aus. Aus Massumis Sicht muss es um die Diagnose dieser Prozesse und ihrer Anziehungskräfte gehen.
Hier zeigt sich die große Stärke der prozessphilosophischen Perspektive auf den Trumpismus, die auch den Blick auf die historischen Faschismen zu inspirieren vermag: Sie sensibilisiert für Muster, die unter unterschiedlichen Bedingungen immer nur verwandelt wiederkehren. Die Frage «ist das Faschismus?», die noch immer die feuilletonistische Berichterstattung über Trump dominiert, wird hinfällig. An ihre Stelle tritt die Diagnose faschisierender Tendenzen und die Analyse ihrer Modi. Oder anders gesagt: Es ist egal, ob Trump ein Faschist ist oder sich als Faschist versteht, wenn er faschistisch wirkt. Zu verstehen gilt es, wie, unter welchen Bedingungen und mit welchen Mechanismen diese Wirkung sich entfaltet, und zwar auch dort, wo man nicht von Faschismus sprechen würde.
Hier kommt bei Massumi eine weitere Vorbedingung für das aktuelle Erstarken faschistischer Affektregime in Amerika ins Spiel: Der «War on Terror» hat für Massumi nämlich das Gefühl der Gefahr verallgemeinert, dabei aber zugleich verteilt: Der Feind ist mitten unter uns, überall und nirgendwo. Wachsamkeit und Feindzuschreibung müssen deshalb genauso verallgemeinert und auf Dauer gestellt werden. Keine Passion, so schreibt Massumi in seiner Diskussion des konservativen englischen Philosophen Edmund Burke, führt direkter zu reaktionären Mustern als die Angst. Die Konstruktion einer existenziellen Bedrohung findet ihre Entsprechung daher in der Behauptung, ständige Entscheidungen seien nötig. Die muss jemand dann natürlich auch unmittelbar, und das heißt unter Umgehung der bestehenden institutionellen Arrangements, treffen. Als dieser jemand bietet sich Trump selbst an. Rule by decree verbindet sich mit rule by tweet: die beständige Kommunikation von Handlungsmacht. Als Performance der Notwendigkeit von Ausnahmeherrschaft stellt sie zugleich mit jeder Entscheidung die Annahme eines Ausnahmezustands wieder her – und schafft so die Bedingungen ihrer eigenen Verstetigung mit. Beides, die präsidentiellen Erlässe wie die präsidentiellen Tweets, schoss mit Beginn der zweiten Amtszeit Trumps dann auch durch die Decke.
Wie könnte angesichts dieser niederschmetternden Diagnose einer trumpesken, sich gegen Einsicht verschließenden Epistemologie, die ein affektives Regime des Reaktiven stützt, aber das antifaschistische Leben aussehen, zu dem Massumis Faschismustheorie laut Untertitel beitragen will? Es müsste wohl eine Lebensweise sein, die sich den Anziehungskräften der Vereindeutigung und der Verlockung durch die Lizenz zu entziehen vermag, ein Denken, das als Denken-Fühlen der Berührung durch die Wirklichkeit begegnet.
Dafür ist es paradoxerweise nötig, vor dem Regen der Zeichenspitzen zumindest zeitweise Unterschlupf zu suchen. Massumi bezeichnet einen solchen Unterschlupf mit einer Wendung Deleuzes als Hohlraum der Nicht-Kommunikation. Er ist die Voraussetzung, um die Situation wahrnehmen, erfühlen und erdenken zu können – und das wiederum die Bedingung dafür, sie und sich dabei zu verwandeln.
Dazu gilt es «eine Verzögerung zwischen dem Auslösen des Zeichens und der gefühlten Wirkung herzustellen – eine Art ‹Latenzzeit›, die den automatischen Reflex unterbricht, sofort eine Ursache zu benennen und Schuld zuzuweisen.» Braucht es für diesen Schluss den ungeheuren philosophischen Aufwand? Fast 300 dichte Seiten Massumi-Prosa sind, wenn sonst nichts, mindestens eine gute Gelegenheit, das Handy einmal auszuschalten. Man liest und beobachtet die eigene Reaktion etwas genauer, bei mir etwa das unwillkürliche Zusammenkrümmen – to cringe – angesichts so mancher Textstelle. Dann kann man sich fragen: Was berührt mich da eigentlich so unangenehm? Was hat das mit dem Text, was mit mir, was mit der Situation zu tun, in der ich mich mit dem Text befinde? Beim Ping-Ping-Ping, das ertönt, sobald ich das Handy wieder anschalte, schließt sich der Hohlraum allerdings sehr schnell wieder. Um ihn nicht zuletzt in den Institutionen der Bildung, der Forschung und des Denkens gegen die faschistische Maschine, die auch hier längst läuft, zu verteidigen, werden sich diese, nur so viel ist sicher, verwandeln müssen.
Brian Massumi: The Personality of Power. A Theory of Fascism for Anti-Fascist Life (Duke UP 2025)