Ständige Vertretung Eine Retrospektive zu US-Filmen auf der Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche zu Zeiten der DDR

Harlan County, USA (Barbara Kopple, 1976)
© Cabin Creek Films
«Come all of you good workers | Good news to you I’ll tell | Of how that good old union | Has come in here to dwell | Which side are you on? | Which side are you on? | Which side are you on? | Which side are you on? | My daddy was a miner | And I’m a miner’s son | And I’ll stick with the union | Till every battle’s won.» Das singt Florence Reece, Ikone der Bergarbeiterbewegung von Kentucky und Protagonistin der erbitterten Arbeitskämpfe von «Bloody Harlan» in den frühen 1930er Jahren, gut vier Dekaden später mit brüchiger Stimme ins Mikro einer Gewerkschaftskundgebung in ebendiesem Harlan County. Die Kamera nimmt sie in den Fokus, immer wieder gibt es aber auch Schnitte auf die mitsingenden Arbeiterinnen und Arbeiter. Sie kennen diesen Song – der über die Jahre zahllose Adaptionen, etwa durch Pete Seeger, erfuhr – in und auswendig.
Kämpferische Folk- und Bluegrass-Songs wie Which Side Are You On? tragen, ja erfüllen gänzlich Barbara Kopples Langzeitbeobachtung des Brookside-Streiks von 1973 Harlan County, USA (1976). Hier fanden Jahrzehnte nach den massiven Auseinandersetzungen der 1930er Jahre erneut blutige Streiks statt, wieder ging es den Arbeitern um grundlegende, ihnen bislang von den großen Coal-Mining-Companies verweigerte Rechte; es ging ihnen schlicht um ihre Würde. Rede und Gesang, Folklore und Politik, Sprach- und Schnittrhythmus verbinden sich in Kopples Beobachtungen zu einem der mitreißendsten, im besten Sinne pathosgeladenen Dokumentarfilme, den das linke Amerika wohl bislang hervorgebracht hat. Ein Film, der auch darauf verweist, dass offen politisches, parteiergreifendes Filmemachen dann am effektivsten ist, wenn es uns nicht einfach Ideen entgegenschmeißt, sondern auch das Sinnliche, Spontane, Schöne einbezieht.
Harlan County, USA ist neben Godfrey Reggios Koyaanisqatsi (1982) und Michael Moores Roger & Me (1989) sicherlich der heute bekannteste US-Dokumentarfilm, der zu DDR-Zeiten bei der Internationalen Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche, wie das DOK Leipzig damals noch hieß, gelaufen ist. Von 1962 bis 1989 waren US-amerikanische Beiträge tatsächlich in jedem Jahrgang des Leipziger Festivals vertreten, das bereits 1955 als eine deutsch-deutsche Dokumentar- und Kulturfilmwoche initiiert wurde, dann pausierte und ab 1960 als dezidiert international ausgerichtete Dokumentar- und Kurzfilmwoche an den Start ging. Erklärtes Ziel war es nun, das kulturelle Ansehen der DDR im Ausland zu steigern und zugleich den Filmindustrien der verbündeten «Bruderstaaten» des Ostens und globalen Südens eine Bühne zu bieten. Leipzig verstand sich in diesen drei Dekaden unmissverständlich als Drehscheibe antikapitalistischer und -imperialistischer Stimmen aus aller Welt. «Filme für den Frieden» war, mit geringen Abweichungen, über Jahrzehnte hinweg entsprechend das (selbstredend selbstgefällige) globalpolitische Motto des Festivals.
Dem vor diesem Hintergrund zunächst merkwürdig erscheinenden Befund einer, wenn man so will, «Ständigen Vertretung» von US-Filmen, immerhin aus DDR-Sicht der imperialistische und politisch reaktionäre Weststaat schlechthin, ging die diesjährige, von Tobias Hering und mir kuratierte Retrospektive des DOK Leipzig nach. Gut 150 damals zeitgenössische US-Dokumentarfilme, die in Wettbewerbs- und Nebensektionen in einem Zeitraum von knapp 30 Jahren liefen, konnten wir anhand der im Bundesarchiv eingelagerten Festivalakten ermitteln – das heißt anhand von Programmheften und begleitenden Bulletins, Protokollen der Auswahlkommission, mittels Überzeugungslisten zu den Filmen und einigem mehr. Erstaunlich war für uns zum Beispiel: Es gab Festivaljahrgänge, speziell in den an globalen Krisen und Kriegen reichen 1970er Jahren, in denen über zehn US-Filme in einem Jahr liefen. Und ihre Dunkelziffer dürfte in der Gesamtschau hoch sein, gab es doch das Phänomen sogenannter Kofferfilme, heißt im Reisegepäck mitgebrachte Filme, die nicht im offiziellen Programm des Jahrgangs auftauchten, stattdessen in angemieteten Kabinenvorführungen (den sogenannten Trade Shows) einem kleinen Kreis von Eingeweihten vorgeführt wurden.
Über die heute noch greifbaren Filme der offiziellen Programmsegmente lässt sich ein guter, wenn auch freilich lückenhafter Überblick zum (radikal-)politischen Dokumentarfilmschaffen in den USA während ihrer massiven innen- wie außenpolitischen Konfliktherde gewinnen. Die Filme erzählen aber auch eine Menge über die DDR und ihr Amerikabild. Der Retrospektive «Un-American Activities» ging es zugleich um Eigen- und Fremdbilder der USA, die der Blick auf die Leipziger Festivalgeschichte offenbart. Die eigene Festivalgeschichte bespiegelnde Retrospektiven haben dabei in Leipzig Tradition. Seit 1990 richtet die Sektion immer wieder den Blick auf eine Geschichte, entlang derer sich die offiziöse Kulturpolitik des Staates während des Kalten Krieges, aber eben auch Uneindeutigkeiten und Widersprüche aufzeigen lassen. Das Bild einer innen- wie außenpolitischen Prestigeveranstaltung ersten Ranges, bei der zu jeder Zeit ein klarer staatspolitischer und -tragender Auftrag gegeben war, wird mit Blick auf die Vielfältigkeit der dort programmierten Positionen mitunter brüchig.
Ist den Verantwortlichen in Leipzig (übrigens ein schwer durchschaubares Geflecht aus Direktion, Auswahlkommission, Komitee und Partei) der ein oder andere Film, der sich kritisch auf das Leben in der DDR beziehen ließ, durchgerutscht, oder gab es solche Freiräume, solange sie nicht offen dissidentisch waren? Das sind komplexe Fragen, die – trotz Aktenbergen – in der Rückschau schwer zu klären sind. Fest steht, dass die US-amerikanischen Festivalbeiträge zwischen 1962 und 1989 zusammengenommen ein mehrstimmiges, sicherlich nicht holzschnittartiges Bild der USA ergeben. Und dass sie den einen oder die andere im Kino zur Frage veranlasst haben dürften, wie freiheitlich überlegen die DDR wirklich ist, etwa, wenn ein Film wie Harlan County, USA unabhängige Streiks und Arbeitskämpfe ins Bild setzt, von denen – freilich unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen – doch im eigenen Land keine Rede sein konnte. Was waren das also konkret für US-Filme, denen Leipzig so beständig eine Bühne bot, die in der Ost- wie Westpresse besprochen und nicht selten mit einer Taube ausgezeichnet wurden?

Committee on Un-American Activities (Robert Cohens, 1962)
© Radical Films / Cohen
Fangen wir am Anfang an: Robert Carl Cohens Committee for Un-American Activities (1962), ein heute vergessener Hybrid aus Dokumentar-, Archivkompilations- und Spielfilm, ist einer von drei US-Filmen, die 1962 den Weg nach Leipzig fanden. Beim erneuten Sichten bin ich erstaunt über die Verspieltheit des Films, ja seine Essayfilmhaftigkeit. Immerhin ist das ein Attribut, das nicht allzu viele US-Filme auf dem DOK zu DDR-Zeiten auszeichnet, hier aber so selbst- wie formbewusst die 45-minütige Laufzeit bestimmt. Cohens Film, der der Retrospektive ihren Titel «Un-American Activities» gab, kreist um das 1938 gegründete House Un-American Activities Committee (HUAC), ein dem Abgeordnetenhaus angegliederter Untersuchungsausschuss, der US-amerikanische Sympathisant:innen des nationalsozialistischen Deutschlands aufspüren sollte. So weit so gut. In der Nachkriegszeit wurde das Komitee jedoch zur führenden Anti-Commie-Instanz umgewidmet, folglich zum Sinnbild des paranoiagetriebenen Rundumschlags gegen als «Kommunist:innen» und damit als potentielle Staatsfeinde gelabelte Andersdenkende aller Art – in der Regel ohne je Beweise gegen diese US-Bürger:innen anzuführen. Eine un-amerikanische Institution.
In Committee for Un-American Activities ist es denn auch ein – und das ist die Spielfilmhandlung – ordinary man, ein amerikagläubiger Typ von nebenan, dem so langsam dämmert, dass das Komitee seine Interessen gar nicht vertritt, in einem rechtlosen Raum agiert. Unterstützt wird seine (das heißt auch: unsere) Bewusstwerdung durch eine Montage von Archivmaterialen zur Arbeit des HUAC, die einem polemischen Verriss gleicht. Zugleich kommt mit jungen engagierten Menschen, die für ihre und die Rechte anderer auf die Straße gehen – und dafür weggeknüppelt werden –, immer wieder der zivile Ungehorsam ins Bild. Es sind Repräsentant:innen eines progressiven, eines «anderen» Amerika, wie man es in der DDR offiziell nannte und gerne bei der Dokumentar- und Kurzfilmwoche präsentierte. So verstanden, reihen sich diese zu Menschen wie der Sängeraktivistin Florence Reece aus Harlan County, USA ein, zu solchen US-Bürger:innen also, die die Ideale des linken Amerikas der 1930er bis 40er Jahre wach- und hochhalten.
Dass ein Film wie Committee for Un-American Activities mit Blick auf den Autoritarismus der gegenwärtigen Trump-Administration und deren systematische Repressionen gegen alles, was – ebenso diffus wie zu Zeiten des HUAC – als «radical left» gilt, schlagend aktuell ist, darauf verwies der live aus Los Angeles zugeschaltete 95-jährige Cohen selbst beim Festival. Auch die im Gegensatz zu Cohen heute noch aktiven US-Filmemacher:innen von damals, mit denen wir in Leipzig sprachen – unter ihnen Barbara Kopple, Deborah Shaffer, Jim Klein, Allan Siegel und Gordon Quinn –, zeichneten ein düsteres Bild. Sie berichteten, wie dünn die Luft für sie gegenwärtig in den USA wird. Vieles, gegen das sie in ihren teils 50 Jahre alten Filmen mal mit aktivistischer Verve, mal mit mehr nüchtern vorgetragenen Analysen ankämpften, beispielsweise gegen den tiefsitzenden Rassismus und Sexismus ihres Landes, ist heute so salonfähig wie lange nicht mehr. Die US-Regierung setze merklich alles daran, über Jahrzehnte etablierte Strukturen wie Funds zu zerschlagen, die ihnen bislang die Herstellung von Filmen ermöglichten. Entsprechend empfanden es unsere Gäste als ermutigend, ihre Filme eines «anderen Amerikas» erneut in Leipzig vorzustellen (strikte DDR-Sympathisant:innen sind sie allesamt übrigens nur sehr bedingt gewesen), zumal einem für Retrospektiven-Verhältnisse jungen, politisch wachen Publikum, wie sie betonten.

Sunday (Dan Drasins, 1961)
© Drasin
Von der Hoffnung auf die Jugend als einer progressiven politischen Kraft handelte auch ein weiterer US-Film, der 1962 in Leipzig gezeigt wurde: Dan Drasins Sunday (1961), heute ein Klassiker der Dokumentarfilmströmung des Direct Cinema (das in Leipzig zu DDR-Zeiten im internationalen Vergleich auffällig unterrepräsentiert bleibt, vermutlich da man dessen kommentarlose, Zeitgeschehen zunächst einmal registrierende Methode stark mit bürgerlichem, vermeintlich apolitischem Naturalismus assoziierte). Sunday ist die unerschrockene Chronik eines Tages, destilliert auf 17 Minuten: Am 9. April 1961 fanden sich im New Yorker Washington Square Park Hunderte Folkmusiker:innen zusammen, um gegen ihre nicht verlängerte Auftrittsgenehmigung zu demonstrieren. War der Park bis dato das Epizentrum der Beat-Szene, sehen sich die jungen Leute nun zügelloser Polizeigewalt gegenüber. Die Situation eskaliert. Drasins Kamera schlängelt sich hindurch, wir mittendrin, Woody Guthries ikonische Liedzeilen «This land was made for you and me» erklingen aus dem Off. Folk und Protest – eine kraftvolle Einheit, wie viele US-Filme in Leipzig zwischen 1962 und ’89 zeigen.
Sunday ist ein frühes Manifest der aufkeimenden Protestkultur in den Vereinigten Staaten ab den 1960er Jahren. Sie zieht sich, wenn die Filme nicht gerade von linken Veteran:innen der Zwischen- und Kriegszeit handeln (z. B. Union Maids, 1976, und The Good Fight: The Abraham Lincoln Brigade in the Spanish Civil War, 1984) – als Leitmotiv durch «Un-American Activities». Break & Enter (1971), ein Film des militanten Newsreel Kollektiv, gibt etwa Einblicke in die New Yorker Hausbesetzer:innen-Szene, die von Familien aus Puerto Rico und der Dominikanischen Republik angeführt wird. Die Anti-Vietnamkriegsbewegung der späten 1960er und frühen 70er Jahre ist getreu des Festivalmottos ein Dauerbrenner in Leipzig: Sons and Daughters von 1967 und Different Sons von 1971 stehen hierfür, ebenso wie ein weiterer Newsreel-Kurzfilm namens Army (1969). Doch auch der Einsatz solcher Protestfilme war in Leipzig nicht ohne Widersprüche zu haben. Während sie als Ausdruck sich krisenhaft zuspitzender Zustände beim Systemrivalen USA politisch funktionalisiert werden konnten, ist der in ihnen manifeste zivile Ungehorsam etwas, was das SED-Regime bei den eigenen Bürger:innen unterdrückte. Hierfür steht etwa die, nicht zuletzt auch beim DOK, tabuisierte Thematisierung des Prager Frühlings im öffentlichen Diskurs.
Je tiefer man in die US-amerikanischen Beiträge zu Zeiten der DDR eintaucht, desto stärker bekommt man ein Gefühl für das weitverzweigte Personengeflecht und für das auf Solidarität fußende Netzwerk unabhängig oppositionellen Filmemachens innerhalb US-amerikanischer Filmzentren der Zeit. So versammelt der Vor- und Abspann eines beliebigen Films in der Regel gleich mehrere Namen, die man von anderen Filmen her bereits kennt. Drasins Sunday wurde etwa von Emile de Antonio produziert. Kein anderer US-amerikanischer Filmemacher unterhielt so beständige Beziehungen zur Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche wie er, nicht nur liefen ab den 1960er Jahren gleich mehrere abendfüllende Filme von ihm in Leipzig – sein Anti-Vietnamkriegsfilm In the Year of the Pig (1968) gewann gar eine Silberne Taube –, Emile de Antonio war auch ein Mittler zwischen dem DDR-Festival und einem breiten Spektrum US-amerikanischer Filmemacher:innen linker Provenienz. Ein Glück für Leipzig, hatte man doch stets Interesse daran, über solche mehr privaten (Um-)Wege mit Protagonist:innen und Produktionszusammenhängen aus Übersee in Kontakt zu kommen, während die offiziellen Verbindungen rudimentär waren.

In the Year of the Pig (Emile de Antonio, 1968)
© de Antonio
«Linke Filme sollen das Publikum visuell und künstlerisch aufrütteln, wie sie das politisch tun sollten. Ich habe vorhandene Bilder genommen und habe sie in einen neuen und damit qualitativ anderen Kontext gebracht. Ich habe sie dazu gebracht, etwas zu enthüllen, was sie in ihrem ursprünglichen Kontext verschleierten: Ich machte sie unwirklich, um sie dadurch wirklicher zu machen.» So beschreibt de Antonio seinen Ansatz des politischen Kompilationsfilms im epischen Interview, das Arno Luik mit ihm 1984 für das Heft 335/336 der Zeitschrift Filmkritik führte, eine dem Filmemacher gewidmete Sonderausgabe, die wegen des Bankrotts des Blattes nicht mehr erschien – das Harun Farocki Institut hat die Veröffentlichung 2018 dann nachgeholt.
Was ist es nun, was die Filme enthüllen? Ich denke, sie treibt vor allem die Offenlegung einer sehr amerikanischen Rhetorik der Macht um. De Antonios Filme kreisen um medial vermittelte Mechanismen des Machterhalts und -missbrauchs. Dialog- und Monologexzesse wie Point of Order (1964) und Milhouse – A White Comedy (1971) sind Found-Footage-Montagen, die nicht weniger als eine Demontage der schillernden Führungsfiguren des ultrakonservativen Amerikas zum Ziel haben. De Antonios Filme sind scharf, kantig, ätzend; es sind persönliche Feldzüge, ohne Rücksicht auf Verluste. Ihre Angriffe zielen im Fall der genannten Filme auf den Senator und selbsternannten «Kommunistenjäger» Joseph McCarthy und seinen – aus Sicht de Antonios – noch manipulativeren Nachfahren, Präsident Richard Nixon. Er darf sich in den Kontrastmontagen und Verfremdungseffektkaskaden von Milhouse bereits gründlich um Kopf und Kragen reden, bevor ihn Jahre später die Watergate-Affäre zu Fall bringen wird.
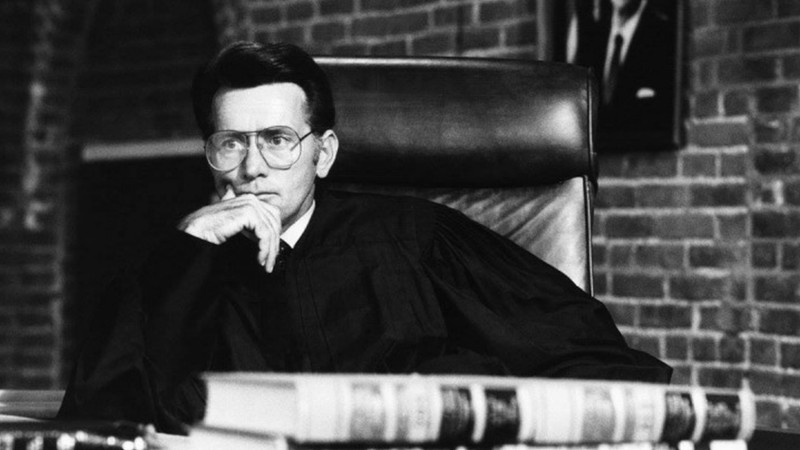
In the King of Prussia (Emile de Antonio, 1982).
© de Antonio
Ein Film de Antonios, der anders als seine Kompilationsfilme funktioniert und in Leipzig vermutlich nur in einer der besagten Trade Shows lief, trägt den seltsamen, jedoch ganz prosaisch aus dem Namen eines Städtchens in Pennsylvania abgeleiteten Titel In the King of Prussia (1982). Für mich ist er aus mehreren Gründen sein aufregendster Film. Es geht damit los, dass de Antonio den Film super low budget auf Video drehte, dann aber zeittypisch auf 35 mm-Filmmaterial in den Verleih brachte. Heraus kommt eine medienhistorisch wie sinnlich eigentümliche Melange, vor allem auch im Kinosaal, wo das warme Analogfilmlicht auf matschige Videobilder trifft. Im Gegensatz zu seinen anderen Filmen ist dieser spontan; er ist eine schnelle, auch etwas unkontrollierte Angelegenheit: Noch während ihr Berufungsverfahren lief, reenacten christliche Pazifist:innen der Gruppe Plowshares Eight gemeinsam mit dem Filmemacher ihr Gerichtsverfahren samt Schuldspruch.
Was war geschehen? Die Acht drangen in eine Fabrik ein, die im Geheimen Teile für die Atomrakete Mark 12A produzierte, und hielten hier eine Art Happening ab. Ein legitimer Protest im Angesicht des atomaren Hochrüstens, betonen sie stoisch vor Gericht; ja statt ihrer selbst wollen sie die Politik auf der Anklagebank wissen. Während die acht in In the King of Prussia als Laien in einem notdürftig zum filmischen Gerichtssaal umgemodelten Hotelkonferenzraum auftreten, wird ihr Widersacher, der rechte, augenscheinlich voreingenommene Bundesrichter von keinem geringeren als der New-Hollywood-Ikone Martin Sheen gespielt. Und wie. Sheens verschwitztes Gesicht droht förmlich zu platzen, seine Adern auf der Stirn pumpen. Eine darstellerische Tour de Force. Sie steht im Kontrast zu den Dokumentarfilmaufnahmen, die de Antonio den Gerichtsszenen beigibt, und die ganz spontanistisch, ohne inszenatorische Finesse die Plowshares Eight beim gemeinsamen Protest und Gebet einfangen. In the King of Prussia ist auf vielen Ebenen ein partizipativer Film. Es ist ein Film von und für seine Protagonist:innen, durchaus im Kontrast zu den früheren Montagefilmen de Antonios, die spürbar das Werk eines freien Auteurs sind, eines trotz seines Netzwerkens auf seinen politischen Einzelkämpferstatus bedachten Mannes.
Gewissermaßen komplementär zu dieser Haltung zeigte «Un-American Activities» auch Filme, die dezidiert kollektiv, das heißt ohne Gewicht auf Regiecredits und Urheberschaften sowie mit eigener Vertriebsstruktur entstanden. Dass sie ab den späten 1960er Jahren gehäuft und in den 1970ern zigfach in Leipzig auftraten, ist vermutlich weniger einer programmatischen Entscheidung des Festivals für kollektive Arbeitsformen per se als dem Trend der Zeit und den heißen Themen der Filme geschuldet. Denn das Aufkommen von Filmkollektiven scheint eng mit einer aktivistisch-militanten Auffassung des Mediums verbunden zu sein, die zu Zeiten des Protests etwa gegen den Vietnamkrieg, strukturellen Rassismus und ökonomische Ungleichheit im besagten Zeitraum virulent wurde.
Neben dem Newsreel-Kollektiv, das gradlinig den Film als Waffe versteht, fällt das Chicagoer Kollektiv Kartemquin Films ins Auge – für Tobias Hering und mich gehört es zu den großen Entdeckungen unserer Recherchen. Über Kartemquin Films, das von Mitte der 1960er bis Ende der 70er Jahre als Kollektiv auftrat, und seitdem als Non-Profit-Produktionsfirma existiert, ließe sich viel sagen. Nur so viel: Es schuf politische Filme mit klarem Auftrag, Filme, die Überzeugungsarbeit leisten. Sie funktionieren aber, so habe ich den Eindruck, demokratischer, das heißt weniger vorformuliert oder als Salve geschossen wie bei Newsreel. Die Filme von Kartemquin Films sind keine Diktate, sondern offene Debatten. Sie arbeiten mit den Protagonist:innen, die sie darstellen, lassen unterdrückte Stimmen ans Mikrofon – und sie wollen erreichen, dass wir uns selbst als Teil der Aushandlungen verstehen.
The Chicago Maternity Center Story (1976) ist etwa ein Film, den es unbedingt wiederzuentdecken gilt: Ein mitreißender Community-Film über eine von der Schließung bedrohte, dringend benötigte Geburtenklinik in einem prekären, vor allem von Schwarzen bewohnten Stadtviertel Chicagos. Zugleich ist der Film in ästhetischer Sicht ein – Cohens Committee on Un-American Activities nicht unähnlicher – Essay, ein verspielter Parcours durch die Geschichte der Kommerzialisierung des US-amerikanischen Gesundheitswesens. Unverhofft wabert gar eine psychedelische Archivbildmontage zu Black Sabbaths Iron Man über die Leinwand. Ein Film, der überrascht, der weit entfernt von schnöder Funktionskunst ist, die man womöglich mit «engagiertem» Film kurzschaltet. Handelsübliche Agitprop war bezogen auf US-Filme in Leipzig eher die Ausnahme als die Regel, soviel konnte die Retrospektive durchaus auch entgegen unseren eigenen Anfangsvermutungen zeigen. Und «un-american» sind die US-Filme auch nur durch die Brille eines McCarthy-Reagan-Trump-Amerikas. Sie gehen in Konfrontation mit dem eigenen Land, dessen Versprechen sie nicht eingelöst sehen. Sie haben die Hoffnung auf die USA – trotz allem – noch nicht aufgegeben
Die Retrospektive Un-American-Activities lief vom 24. Oktober bis 8. November 2025 beim DOK Leipzig. Im Januar 2026 findet im Potsdamer Filmmuseum und dem Zeughauskino Berlin ein Nachspiel einiger ihrer Filme statt. So zum Beispiel Harlan County, USA, Committe on Un-American Activities, In the King of Prussia und The Chicago Maternity Center Story