17. Dezember 2022
7 x Nobuhiko Obayashi
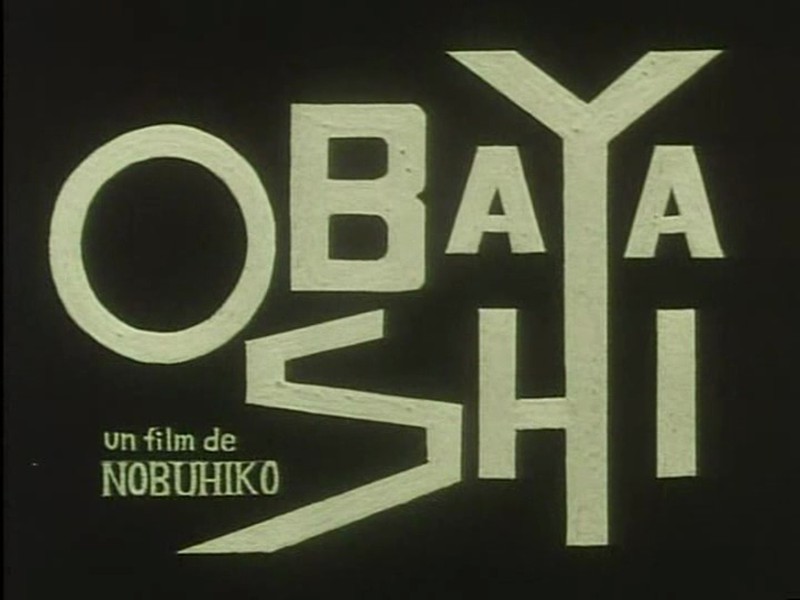
Emotion (1966)
Ein Ankerwurf, aka Referenz, gleich zu Beginn, Stills aus Roger Vadims Vampirfilm Et mourir de plaisir. Das Vampirische wird erst gegen Ende der knapp vierzig Minuten von Obayashis Film expliziter, mit Blut, eine Frau geht einer anderen mit einer Art Strohhalm an den Hals. Ein Dracula mit schwarzem Umhang und Messer. Dazwischen jedoch eine unkontrollierbare Montageflut aus Kontinuität und Diskontinuität, sehr buchstäblich in wiederkehrender Stop-Motion, ein Vorwärts mit Beinen und Füßen, die still sind. Zwei Frauen, draußen, Schirme, die fliegen, Männer fallen aus einem Baum, mal steht oder geht was auf dem Kopf, Schwarz-Weiß wechselt zu Farbe, Farbe zurück zu Schwarz-Weiß. Zu allem, immerzu, auch wechselnd, Musik, melodisch, scheppernd, munter jazzig, Easy Listening oder Ye Ye, exuberante Wechselströme des Sounds zu exuberanten Wechselströmen des Bilds. Every silly trick in the book, aber welches Buch, es gibt kein Buch, nur die Freude am Spielen. Dass man dem folgen kann, wäre zu viel gesagt, oder falsch gesagt. Man hakt sich da fest, es zerrt, schleudert einen mit, man zappelt im zappelnden Netz. Oder man bleibt draußen, steht selbst still und blick auf das hektische Treiben, dann ist es, als zöge eine fröhliche Bilder-Stampede vorüber. (67cp)
Hausu (1977)
Ins eigene Haus hat der Vater eine Neue geschleppt. Glasbausteine verstellen den Blick, der Himmel spielt, aber das tut er in diesem Film immer, sonnenuntergangsverblendet verrückt. Und so machen die jungen Frauen, der Film hat ihre Eigennamen vergessen, weshalb sie nur Melody, Professor, Fantasy etcetera heißen, so machen sie sich also auf ins andere Haus, in dem im Rollstuhl die Tante regiert, und mit ihr die Katze, die einen Eigennamen hat, nämlich Blanche. Im Haus tut sich nun manches, erst Andeutungen, dass was nicht stimmt, erst kleine Spielereien, Quatsch mit Melone, grünes Blitzen der Katzenaugen. Dann ist es mehr, das nicht stimmt und dann dreht der Film völlig durch. Der Horror, falls es ein Horrorfilm ist, besteht darin, dass sich jede Andeutung nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt, ins Extrem geht. Ins Klavier ist irgendetwas gefahren, mit billigen Tricks, dann kappt es die Finger, die spielen weiter, dann schnappt sich das Klavier die ganze Person, verspeist sie, oder wie immer man beschreiben will, was mit ihr passiert. Die Tante kann gehen, das Haus verselbständigt sich. Blut, Wasser, Bildbearbeitung tobt sich aus, wenn hier von Realismus die Rede sein kann, dann ist es ein Realismus dessen, was technisch an Spielerei denkbar und machbar sein kann. Es ist das Medium, das hier verrückt spielt, Obayashi eilt dem, was sich machen und denken lässt, hinterher oder voraus. Das Kino ist das Medium, in das der Teufel wie in eine Trickkiste fährt. Weil es auf Exzess und Wändewackeln und Hexensabbat hinauslaufen will, ist die Wahllosigkeit, die kein Halten mehr kennt, nicht bug, sondern feature. Ja, da sitzt dann ein Mann aus Bananen im Auto. Ja, das springt haltlos, bringt zersäbelte Körperteile zum Tanzen. Das Haus wie die Körper als Körper, denen alles zuzutrauen ist, pubertierende Körper, ein Medium, das sich in den Wahnsinn hinein experimentiert, Kino, das nichts als Kino sein will und eine Maschine ist, die keinen Stein auf dem anderen lässt. (75cp)
Visitor in the Eye (1977)
Zwei Hunde folgen dem Spiel, drehen die Köpfe nach rechts und nach links, Tennis. Ein Ball geht ins Auge, auf dem die junge Frau deshalb erblindet. Die Stimmung bleibt dennoch relaxt, alles von einem sehr sanften Wahnsinn (nach Osamu Tezuka) umspült. der Lehrer, der sich schuldig fühlt, fährt einen Berg hinauf, wo einer wohnt mit weißem Haarschopf und trauriger blauer Backe, das ist Blackjack mit seiner mädchenjungen Frau, der kann so etwas reparieren. Und so wird repariert, es braucht nur ein anderes Auge dafür, das lässt sich in der Augenbank finden. Smooth, immer smooth, läuft Musik. Die Operation im zugerümpelten Haus ganz weit oben reüssiert, auf eine Art. Allerdings: Die junge Frau hat sich mit dem Auge einer Toten einen schweren Fall von mörderischer Vorgeschichte zugezogen, es zieht sie in ein Haus, in dem die Kamera die Räume gerne von oben betrachtet, der Blick leicht verstellt, statt ziemlich easy listening nun ziemlich heavy Klavier. Schwere See, leuchtender Ball, es wird, im weiterhin sanften Wahnsinn lind emulgiert, romantisch, aber nicht ernst; und auch im Ernst nicht romantisch, es ist eine Freue am Gleiten von Bild zu Bild, die am Ende regiert. (73cp)
Tenkosei (1982)
Ein Stolpern, eine gekickte Büchse, ein Fallen, ein gemeinsames rollendes Stürzen von Kazumi und Kazuo eine steile, lange Treppe hinab. Wechsel von Schwarz-Weiß zu Farbe, diesmal motiviert, denn erst am Ende kehrt das Schwarz-Weiße als Realitäts-Anzeiger zurück. Nun aber, in der Farbe, wird eine Body-Switch-Fantasie ausagiert. Kazumi steckt in Kazuos Körper, Kazuo im Körper Kazumis, ein Schreck, ein Staunen ist so vice-versa in beide gefahren, Griff an die Brüste, Griff an den Penis, zunächst werden die Affekte und Scherze (qualvoll sind und bleiben, bei allem, was sich sonst nach und nach löst, die starren Gender-Klischees) fast alle unter die Gürellinie platziert, das alles sehr viel mehr generische Pubertäts- als speziell Gender-dysphorisch, mal lustig, mal akward, mal grenzwertig, immer aber eingebettet in einen kleinen Ort an einer Meeresbucht, unspektakulär in den Straßen, hübsch in den Totalen, ohne erhaben zu sein. Das alles ohne die üblichen Manierismen gefilmt, vernacular filmmaking in a vernacular town, im Hintergrund sind die peer groups der Schule und die Familien immer präsent. Und just, wenn man glaubt, dass dem Film nun gar nichts mehr einfällt, bricht er auf in eine (nicht zu ferne) Ferne, eine sonnenuntergangsgetränkte Totale zu Bachs Air, Kazumi und Kazuo machen sich auf eine Reise per Boot, geraten in eine Feiergesellschaft und schlafen in der Ferne ein, Händchen haltend, das alles wie ein langes, schönes, berührendes Durchatmen. Wenn am Ende alles wieder zurechtgekugelt sein wird, geht Kazuo als erstes beglückend Pissen im Stehen. Der Wechsel zurück ins Schwarz-Weiß des Normale erfolgt jedoch leicht verzögert. Am Schluss noch ein Abschied: Kazuo reist ab, filmt Kazumi, die winkt, die sich umdreht, die mit dem Rücken zu ihm zurück zu ihrer Familie geht. Erst schleichend, dann hüpfend. (75cp)
His Motorbike, Her Island (1986)
Hier ist gar nichts stabil. Nicht nur die Motorräder in rasender Bewegung, mal sich in Kurven schmiegend, mal jagen sie kämpferisch gegeneinander. Unfälle sind der Job des Protagonisten, er liefert als Motorbote die Bilder zur Zeitung. Er ist der Ich-Erzähler, ja, aus dem Off, aber diese Erzählung stabilisiert nicht, sondern trifft den Film nur gelegentlich als Blitz aus mehr oder minder heiterem Himmel. Nichts ist stabil: Da ist erst die eine Freundin, mit ihr macht er, nachdem er die andere trifft, erst mal Schluss. Was nicht heißt, dass sie gänzlich verschwindet, weil nichts hier verschwindet, Abschiede gibt es nicht, weil auch die Begegnungen kaum mehr als zu wechselnder Popmusik wie fantasiert sind. Der Wechsel von Schwarz-Weiß zu Farbe geschieht, und geschieht oft, es gibt aber kein Prinzip, das ihn organisiert. Manchmal trägt er sich innerhalb der Einstellung zu, manchmal vom einen zum anderen Bild, die Montage fragt ohnehin nicht nach Gründen, es geht um die Beweglichkeit, das Bewegtsein, den Wechsel selbst, als Prinzip, das seine Gründe nicht kennt. So wird gesungen, geliebt, motorradgefahren, in der Stadt, auf dem Land, dort wird bei einem traditionellen Dorffest zum Singen getanzt. Ob der Crash am Ende real ist oder fantasiert, ob das Happy End fantasiert ist oder real: Falsche Frage, fundamental ist, dass genau diese Unterscheidung nach Möglichkeit kollabiert. (72cp)
Ryuu - The Motive (2004)
Vier Tote, ein komplizierter Mordfall, bei dem die Dinge anders liegen als man denkt, und seine gründliche Aufarbeitung. Es gibt zwei ermittelnde Polizisten, es gibt einen Kreis von Verdächtigen. Darum herum jedoch einen weiteren Kreis: der Beteiligten, der Nachbarn, der Zeugen und anderer Personen, denen teils ausführlichere Porträts gewidmet sind. Dieser Mord berührt eine Unzahl von Personen, mit großer Geduld öffnet der Film eine Tür nach der anderen, zeigt, erzählt, berichtet. Man verliert irgendwann ein wenig den Überblick, aber das ist durchaus Absicht, es macht nichts, ja, es mindert nicht einmal die Spannung. Riyuu gibt sich als Mischung aus Dokufiktion und Spielfilm. Ein Filmteam sucht die Beteiligten auf, rekonstruiert das Geschehen, führt Interviews. Immer wieder tritt jemand ins Zimmer, der dem Dokufilm-Team, das man nicht sieht, etwas zu trinken anbietet. Im rosa Kleidchen steckt das Telefon, sanft verstrubbelt ist die Hausmeisterfrisur. Obayashi nimmt sich die Zeit (160 Minuten) und zieht einen in seine Welt, er hebt einen geradezu in ihr auf. Es dominieren die falschen Farben, körniges Bild-Geriesel, und immerzu, immerzu spielt dazu die Musik. (74cp)
Labyrinth of Cinema (2019)
Dieses Drei-Stunden-Werk hat Obayashi, unheilbar erkrankt, dem Tod abgerungen. Der Schauplatz: ein Kino in seiner Heimatstadt Onomichi, die in der Präfektur Hiroshima liegt. Der Schauplatz: die Vergangenheit, Japan entlang der Geschichte von Kriegen erzählt. Der Schauplatz: das Weltall, hier treibt ein älterer Herr, ein Kommentator-Erzähler, Goldfische im Vordergrund, während des Films sitzt der Herr, ein Obayashi-Standin, im Kino, greift nach dem roten Faden und lässt ihn auch wieder fallen. Das Kino in Onomichi wird schließen, alt ist der Betreiber, zum Aufhören alt, analog der Projektor, forciert digital aber der Film, der so oder so aus der Künstlichkeit seiner Bilder und Mittel, vor allem seiner Bildkompositionen nicht nur keinen Hehl macht, sondern das Komponierte mehr als das Gezeigte in den Vordergrund rückt. Im Publikum drei junge Männer, die es jedoch bald ins Geschehen hineinzieht, von Krieg zu Krieg, einer schreibt in seinem roten Notizbüchlein mit. Sie wollen retten, nicht kämpfen, und müssen doch erleben, wie Noriko, die Heldin, die mythisch vielgestaltig durch die Zeit unterwegs ist, in Hiroshima stirbt. Stirbt, wie die ganze Theatertruppe, zu der sie gehört. Hier, vor der Atombombenexplosion, kommt der Film beinahe zu etwas wie Ruhe und Atem, zuvor hetzt er durch Zeit und Form, Musical hier, Kriegsgemetzel da, blutroter Sonnenuntergang, Körper im digitalen Wasser als künstlichem Element, nur das Kino (das von Obayashi) ist in dieser Künstlichkeit ganz zuhause. Oft, ja meist, sind Schriftzeichenfahnen im Bild. Zitiert werden die nüchternen Verse des Dichters Chuya Nakahara, 1907-1937, er hat den großen Krieg nicht mehr erlebt, aber was Obayashi zeigt, gibt ihm recht: «Ihr nennt es Moderne, ich nenne es das Zeitalter der Barbarei.» Zwischendurch ist einmal, nachgestellt, Ozu zu sehen, eine Animationsfigur flattert von der Leinwand ins Leben, und in einer der vielen Faltungen seines Labyrinths sitzt Obayashi himself, alt und krumm, und spielt auf einem Klavier, seinem Tod entgegen, der Zukunft entgegen, für die er die Hoffnung nicht aufgeben will: Sie liegt doch in unseren Händen, oder denen unserer Kinder. (80cp)

Labyrinth of Cinema
© Crescendo House